Aktivisten im Netz – Verschlüsselungstechnologien für unsere Gesellschaft

Wie wird öffentlich über Verschlüsselungstechnologien, also Kryptografie, diskutiert?
Meist findet das im Kontext von aktuellen Debatten statt. Nach Terroranschlägen wird beispielsweise oft ein Verbot starker Kryptografie gefordert, welche unter anderem zur Anonymisierung der Netznutzer oder zur Verschlüsslung von Kommunikationsinhalten eingesetzt werden kann. In den USA wurden starke Verschlüsselungsmethoden wie etwa Pretty Good Privacy bis Mitte der 1990er-Jahre als Waffentechnologie eingestuft und mit einem Exportverbot belegt, bis die Electronic Frontier Foundation 1996 ein Grundsatzurteil durchgebracht hat. Seitdem werden kryptografische Systeme und Softwarecodes im Sinne der freien Meinungsäußerung behandelt. Ähnliche Bestrebungen, starke Kryptografie zu regulieren, finden sich auch in Europa, etwa nach den Anschlägen auf das Satiremagazin Charlie Hebdo.
In diesen Debatten wird die Bedeutung kryptografischer Technologien meist auf ihre Rolle im Zusammenhang mit der Ermöglichung anonymer Kommunikation im sogenannten Darknet reduziert. Den von mir untersuchten Akteuren dient die Kryptografie jedoch nicht ausschließlich dazu, undurchschaubare Räume zu schaffen, die vor staatlichem Zugriff geschützt sind. Vielmehr stellt sich ihnen die Frage: Wie können wir in einer Welt, in der sich digitale Technologien durch sämtliche Lebensbereiche ziehen, vertrauenswürdige Kommunikation gewährleisten?
Wer steht im Mittelpunkt Ihres Forschungsinteresses?
Auch wenn es eine transnational vernetzte Szene gibt, habe ich meine Forschung auf zwei netzaktivistische Epizentren konzentriert: Eine stark politisierte Entwicklerszene in Berlin und die Cypherpunk-Community in San Francisco.
Der deutsche Chaos Computer Club ist eine Hacker-Vereinigung, die schon seit den 1980er-Jahren aktiv ist, und die sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technologien beschäftigt. Bei der Electronic Frontier Foundation, kurz EFF, in San Francisco handelt es sich um die bedeutendste Bürgerrechtsorganisation in den USA, die sich mit digitalen Themen beschäftigt. Neben einer Rechtsabteilung arbeiten dort IT-Experten an der Entwicklung kryptografischer Technologien. Die EFF ist außerdem mit der akademischen Forschung in Stanford sowie mit der Start-up-Szene im Silicon Valley vernetzt.
Welche Themen liegen den Aktivisten am Herzen?
Diese „Community of Communities“, so hat es einmal ein Sprecher vom Chaos Computer Club genannt, ist in sich sehr heterogen. In Deutschland spielt für viele AktivistInnen der Datenschutz und die Gewährleistung von verfassungsrechtlich verbrieften Bürgerrechten im digitalen Zeitalter eine zentrale Rolle. In der Entwicklerszene in der Bay Area sind diese Aspekte auch relevant, jedoch kommt hier häufig noch eine libertäre Note hinzu, die in den Idealen der Cypherpunk-Bewegung der späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre wurzelt.
Die Cypherpunks knüpfen an ihre technischen Systeme ein Heilsversprechen. Sie glauben daran, dass ihnen kryptografische Technologien die Möglichkeit bieten, staatlicher Kontrolle zu entkommen und alternative gesellschaftliche Regulierungsformen auf Grundlage dezentraler Systeme zu entwickeln, die immun gegen die Manipulierbarkeit durch mächtige Akteure sind.

Welche Ziele verfolgen Kryptoaktivisten?
Neben dem Schutz von Bürgerrechten wie dem Recht auf Privatsphäre und dem Schutz der freien Meinungsäußerung verfolgt gerade eine junge Generation von Cypherpunks gemäß dem Motto „Code is Law“ das Ziel, Technologien zu entwickeln, die eine regulative Qualität auf soziales Verhalten haben und die Vertrauen in menschliche Institutionen überflüssig machen.
Ein Beispiel hierfür sind sogenannte smart contracts, die Vertragsvereinbarungen in Softwarecode festschreiben und diese gleichzeitig umsetzen. Dahinter steckt die Idee, mathematisch unbestreitbar nachweisen zu können, dass ein Vertrag zwischen den betreffenden Parteien abgeschlossen wurde. Dadurch, dass der Vertrag sich auf Grundlage einer kryptografisch gesicherten Protokollsequenz automatisch abwickelt, soll es menschlichen Akteuren unmöglich gemacht werden, sich innerhalb der Protokolllogik abweichend zu verhalten.
Was zeichnet die Aktivisten als Gruppe aus?
Viele der von mir interviewten Personen sind bereits seit den 1980er- und 1990er-Jahren im Internet unterwegs. Sie haben das Netz also noch zu Zeiten erfahren, bevor die Kommerzialisierung und die damit einhergehende privatwirtschaftliche Monopolisierung und Zentralisierung durch Dienste wie Google und Facebook das Medium einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machten. Die Tech-AktivistInnen betrachten das Internet als einen technisch gestaltbaren, gesellschaftlichen Möglichkeitsraum und gleichzeitig als das zentrale Nervensystem der globalisierten Welt.
Gemein ist den KryptoaktivistInnen, dass sie Teil einer transnationalen Experten-Community aus MathematikerInnen, KryptologInnen, InformatikerInnen, SystemdesignerInnen und SoftwareentwicklerInnen sind, die ein gemeinsames Problembewusstsein eint.
Was für Probleme adressieren Netzwerkaktivisten?
Als Technikexperten nehmen diese AktivistInnen die öffentlichen Debatten über Datenschutz oder den Schutz der Redefreiheit im digitalen Zeitalter als Oberflächenphänomene für viel basalere Probleme wahr.
Anders als Laien verfügen sie über ein grundsätzliches Wissen darüber, wie sich die vernetzte Welterfahrung auf der unsichtbaren Ebene der Netzwerkprotokolle zusammensetzt. Während der Techniklaie nur die Benutzeroberfläche seines Smartphones wahrnimmt und darauf vertraut, dass die Technik funktioniert wie beabsichtigt, rechnen die Technikexperten bereits auf der Protokollebene mit einer Vielzahl ungekannter globaler Angreifer, welche die Kommunikationserfahrung der Netznutzer massenhaft und routinemäßig zu untergraben versuchen.
Welche Bedeutung hat Kryptografie für die Aktivisten?
Die Kryptografie stellt eine Schlüsseltechnologie der IT-Sicherheit dar, gerade um die Prinzipien der Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der Datenvermittlung zu gewährleisten. Es geht eben nicht nur darum, dass die NSA den globalen Kommunikationsfluss passiv mithören kann, sondern auch darum, dass es geheimdienstliche Bestrebungen zur Unterminierung der allgemeinen IT-Sicherheit gibt.
Viele der von mir untersuchten Akteure begreifen kryptografische Systeme als letzten Vertrauensanker in einer Welt, in welcher digitale Daten leicht manipuliert und politisch instrumentalisiert werden können. Der mathematische Beweis, dass sich die digital vermittelte Welterfahrung mit ihren unsichtbaren konkreten technischen Bedingungen deckt, ist für die AktivistInnen von zentraler Bedeutung.
Politische AktivistInnen innerhalb der Entwicklerszene messen den Annahmen, die der Sicherheit kryptografischer Systeme zugrunde liegen, auch eine gesellschaftsgestaltende Qualität bei. Gerade innerhalb der Cypherpunk-Community ist die Idee wirkmächtig, vernetzte Technologien über die Kryptografie so manipulationssicher gestalten zu können, dass ein Vertrauen in die Aufrichtigkeit menschlicher Akteure hinfällig wird.
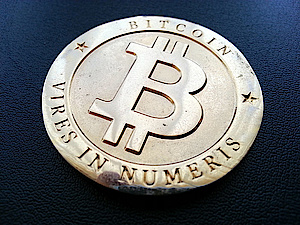
Welche Folgen hat dies für den Umgang mit gesellschaftlichen Problemen?
Als ich angefangen habe, mich mit der Thematik und mit den Akteuren im Feld zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, dass diese Leute bestimmte gesellschaftliche Vertrauensprobleme als über Technologien lösbar betrachten. Gerade, wenn man die Cypherpunk-Community in San Francisco oder Technologien wie Bitcoin oder die Blockchain-Technologie, die da dahinter steckt, betrachtet, dominiert die Idee, Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen und in menschliche Akteure obsolet zu machen und durch ein Vertrauen in die Mathematik ersetzen zu können.
Innerhalb der Cypherpunk-Community ist ein Verständnis vorherrschend, gesellschaftlichen Vertrauensproblemen nicht mehr mit politischen Maßnahmen zu begegnen, denen ein breit geführter gesellschaftlicher Diskurs vorausgeht. Vielmehr wird die Lösung dieser Probleme pragmatisch angegangen, nach dem Prinzip „We reject: kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and running code.“ Dieser Leitspruch stammt von David Clark, einem frühen Internetpionier. Sein Geist ist in der heutigen Entwicklerszene in San Francisco allgegenwärtig.
Gerade die eingangs erwähnten smart contracts sind ein Paradebeispiel dafür, wie Cypherpunks die Umsetzbarkeit bestimmter sozialer Normen über die Mathematik und Softwarecodes regulieren möchten. Die Triebkräfte für gesellschaftlichen Wandel werden hier nicht mehr vornehmlich in der sozialen Sphäre verortet, sondern soziale Prinzipien werden über ihre technische Umsetzbarkeit gedacht. Fragen nach deren sozialer Erwünschtheit werden dabei häufig ausgeklammert.
Klingen auch bestimmte gesellschaftliche Ideale oder Moralvorstellungen an?
Das ist sehr divers und doch gibt es einflussreiche Überzeugungen, etwa die Hackerethik unter den Hackern, die Ideale der Free-Software-Bewegung und vor allem die frühe Internetkultur. Das sind Menschen, die sich selbst als Bewohner des Internets verstehen und das Internet als einen wichtigen ideellen Bezugspunkt sehen, an den sie normative Vorstellungen knüpfen, beispielsweise auf Grundlage freier Meinungsäußerung und freiem Informationsaustausch unter Gewährung der Anonymität, bestimmte Formen von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung zu ermöglichen.
Gerade im US-amerikanischen Kontext klingen häufig republikanische Ideale an, etwa wenn Edward Snowden ein Zitat von Thomas Jefferson aus der Kentucky Resolution von 1798 paraphrasiert und das Wort constitution durch cryptography ersetzt: „Let us speak no more of faith in man, but bind him down from mischief by the chains of cryptography.” In der Kryptografie sehen viele AktivistInnen die Möglichkeit, einen Gesellschaftsvertrag auf der Grundlage mathematischer Prinzipien aufstellen zu können, der die Bürger vor Machtmissbrauch schützt und der herkömmliche Formen der Gewaltenteilung ergänzt oder ersetzt.
Wie nehmen die Aktivisten ihre eigene Rolle wahr?
Viele AktivistInnen begreifen sich als Teil einer Avantgarde, die eben dadurch, dass sie sich der technischen Grundlagen des Internets bewusst ist, auch so etwas wie eine moralische Pflicht verspüren, diesen Raum aktiv mitzugestalten, und die sich auch in einer Bringschuld gegenüber der Gesellschaft sieht.
Gemein ist den von mir untersuchten AktivistInnen auch, dass sie die gegenwärtige Phase der Digitalisierung als Zeitenwende begreifen, in der bürgerliche Errungenschaften, wie das Recht auf Privatsphäre und Kommunikation ohne Zensur grundlegend durch die Art und Weise, wie die Gestaltung des digitalen Raumes durch privatwirtschaftliche und staatliche Interessen bestimmt wird, bedroht werden. Die Kryptografie ist ihnen ein ermächtigendes Gestaltungswerkzeug, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Nicolai Ruh ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“. In seinem Dissertationsprojekt „The Universe Believes in Encryption – Netzaktivismus und postsoziale Imaginationen in den USA und Deutschland“ untersucht er die Perspektive der Netzaktivisten-Community.