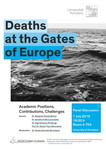Wissenschaft zwischen Distanz und Aktivismus
Bericht einer Podiumsdiskussion anlässlich der Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer
Es diskutierten
- der Geograph Dr. Benjamin Etzold von der Universität Bonn,
- die Freiburger Anthropologin Dr. Inga Schwarz,
- Dr. Karolina Follis, politische Anthropologin von der britischen Lancaster University, und
- Prof. Dr. Daniel Thym, Rechtswissenschaftler und Direktor des Forschungszentrums Ausländer- und Asylrecht (FZAA) an der Universität Konstanz.
Die Wissenschaftler/innen auf dem Podium teilen ihren Forschungsgegenstand: Sie beleuchten die Themen Migration, Flüchtlinge, Asyl an den Grenzen von Europa und werden dabei mit menschlichen Schicksalen konfrontiert. Wie soll man damit umgehen, wenn man erfährt, dass wieder einmal Hunderte von Flüchtlingen im Mittelmeer ertrunken sind, wie etwa am 19. April 2015? Wie politisch dürfen oder sollten Forschende sein? Und welchen Beitrag können sie für Politik und Gesellschaft in der Flüchtlingsfrage leisten?
Dazu vertraten die Podiumsteilnehmer/innen ganz unterschiedliche Positionen: von der nüchternen Feststellung, Politiker/innen würden in der Regel keine wissenschaftlichen Studien lesen, bis hin zu verschiedenen praktischen Handlungsmöglichkeiten. Karolina Follis machte sich stark dafür, dass sich Wissenschaftler/innen nicht distanzieren, nicht in einen Elfenbeinturm zurückziehen, sondern sich engagieren:
„Gesellschaftlich-politisches Engagement kann sehr unterschiedlich aussehen. Manche Forscher übernehmen die Rolle des ‚wissenschaftlichen Aktivisten’ und bewegen sich in beiden Welten, der wissenschaftlichen und der des Aktivismus, was oft unglaublich produktiv sein kann.“
Eine alternative Art von Engagement, meinte die Anthropologin, sei es, an der Politikberatung mitzuwirken, etwa in Think Tanks der Politik empirische Grundlagen für Entscheidungen zu liefern. Anders als in Deutschland, so Follis, wird diese so genannte „impact agenda“ in Großbritannien geradezu erwartet, insbesondere von Institutionen und Unternehmen, die Forschung finanziell unterstützen. Die Rolle der Wissenschaftler/innen mutiert in eine von Berater/innen, was nicht unproblematisch sei:
„Denn die Forschenden mögen ihre Daten und Fakten ehrlich und nach bestem Gewissen erhoben haben. Anschließend aber haben sie keine Kontrolle mehr darüber, was damit weiter passiert, ob sie etwa für partikuläre Interessen von Regierungen oder Parteien eingesetzt werden.“
Inwiefern sind in einer Person die Ansichten von Forscherin/Forscher und Bürgerin/Bürger überhaupt zu trennen? Benjamin Etzold wollte Wissenschaftler/innen als Teile eines sozialen Feldes verstanden haben. Als solche hätten sie die Aufgabe, die Logik und die in diesem Feld wirkenden Mechanismen zu verstehen und sie anschließend zu hinterfragen. „Basierend auf unserer empirischen Forschung mit Flüchtlingen können wir auf Ungerechtigkeiten und Verstöße gegen Menschenrechte hinweisen“, so der Geograph. Wichtig sei, wies Daniel Thym hin, dass man den wissenschaftlichen Prinzipien treu bleibe, wie etwa korrekte Zahlen und Fakten liefere. „Genauigkeit und Transparenz müssen stets garantiert sein“, betonte auch Karolina Follis.
Dass es nicht immer leicht sei, Distanz zu wahren, wusste Benjamin Etzold zu berichten:
„In meiner Forschung habe ich mit Menschen in einer ungeschützten, sehr verletzbaren Position zu tun. Wer hier Feldforschung betreibt, etwa potenziell illegale Flüchtlinge beobachtet und befragt, wird situationsbedingt in das Milieu hineingezogen. Da bekomme ich schon mal einen Anruf von einem meiner Interviewpartner, er sei abgeschoben, müsse zurück nach Marokko.“
Wie will man zwischen der Person, die Teil der eigenen Forschung ist, und dem Menschen, den man persönlich kennt und schätzt, unterscheiden? Von der schwierigen Doppelrolle als Wissenschaftlerin und gleichzeitig sozial Engagierten wusste auch Inga Schwarz zu berichten, deren ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge Studium, Promotion und Post-doc-Phase begleitete: „Wie kann ich sicherstellen, dass die Information, die mir jemand in einem Vertrauensverhältnis gegeben hat, nicht gegen die Informantin oder den Informanten verwendet wird?“ Seit zehn Jahren ist Inga Schwarz in der Flüchtlingsarbeit tätig.
Der Balanceakt, der von Wissenschaftler/innen mit politisch (sozial, ökonomisch, …) brisanten Forschungsgegenständen, zu leisten ist, so zeigte die Podiumsdiskussion, spielt sich auf mehreren Ebenen ab: auf der Ebene der menschlichen und gesellschaftlichen Verantwortung und gleichzeitig auf der Ebene wissenschaftlicher Integrität. Diesem Thema widmete sich auch der zweitägige Workshop „Researching the European Border: From Concept to Method“, dessen Auftakt die Diskussion darstellte. Beides organisierten die Ethnologinnen Corinna di Stefano und Larissa Fleischmann, die am Doktorandenkolleg „Europa in der globalisierten Welt“ des Exzellenzclusters promovieren.
Deaths at the Gates of Europe: Academic Positions, Contributions, Challenges
Podiumsdiskussion im Rahmen des Interdisziplinären Werkstattgespräches „Researching the European Border: From Concept to Method“
1. Juli 2015