Was 400 Jahre alter Streit unter Kaufleuten über die Europäisierung des Mittelmeeres verrät
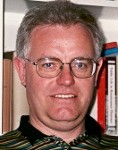

Armenische Kaufleute verklagen einen verschwundenen jüdischen Diamantenschleifer vor dem Sultan; oder: Ein englischer Kapitän setzt seine Passagiere an der Küste aus und verschwindet mit der Ladung. Anhand solch anschaulicher Quellenfunde um Streitfälle aus dem 17. Jahrhundert entfaltet der Historiker Wolfgang Kaiser, Professor an der Université Paris 1 (Panthéon Sorbonne) und Ex-Fellow des Kulturwissenschaftlichen Kollegs Konstanz, den Reichtum seiner Quellen und führt in sein laufendes Forschungsprojekt ein.
Das italienische Livorno ist in der Frühen Neuzeit ein Ort des Kosmopolitismus, an dem sich europäische Seefahrer, jüdische und muslimische Kaufleuten treffen, miteinander Handel treiben und auch streiten. Der interkulturelle Handel zwischen dem christlichen Europa und dem muslimischen Maghreb gilt Kaiser als ein Laboratorium der Entwicklung von Rechtsverfahren – und damit als historischer Hintergrund aktueller Fragen im im europäischen Mittelmeerraum.
Beginnend mit dem Beispiel des 100-jährigen Bücherkriegs des mare clausum gegen das mare liberum des Hugo Grotius fragt Kaiser in seinem Vortrag:
- Wie sah die komplexe Rechtslandschaft im Mittelmeer aus? Mit welchen Traditionen und Institutionen mussten sich die Akteure auseinandersetzen, welche rechtlichen Ressourcen konnten sie nutzen?
- Was lässt sich aus den Handelsstreitigkeiten und Verfahren zu ihrer Beilegung hinsichtlich des gegenseitigen Verständnisses der Akteure ablesen? Was sagen sie über die Formen der Interaktion, hinsichtlich der Machtverhältnisse und deren Entwicklung aus?
- Ergibt sich daraus eine differenzierte Deutung der makrohistorischen Prozesse, d.h. eine kritische Hinterfragung des Prozesses der Europäisierung des Mittelmeeres?
Das laufende Forschungsprojekt Kaisers und seiner Kolleg/inn/en, das die EU mit einem der begehrten ERC-Grants fördert, will „die Idee einer linearen teleologischen Entwicklung zur europäischen Hegemonie im Mittelmeerraum […] hinterfragen“ und „auf einer empirisch mittleren Ebene die Frage […] nach der Europäisierung des Mittelmeeres neu stellen“.
Ein Ergebnis des Forschungsprojektes wird schon jetzt deutlich: Die Beteiligten können die strukturelle Benachteiligung muslimischer Akteure vor europäischen Gerichten des 17. Jahrhunderts nachweisen. Erschwert werden die Recherchen, auch darauf weist Kaiser eindrücklich hin, durch die aktuellen Konflikte in Syrien und Libyen: Die Kämpfe versperren nicht nur den Zugang zu den Quellen, sondern lassen auch das Schicksal der Archivare vor Ort im Dunkeln.
Prof. Dr. Wolfgang Kaiser lehrt Geschichte der Frühen Neuzeit an der Université Paris 1 (Panthéon Sorbonne). Zwischen Oktober 2009 und September 2010 forschte er am Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz über „Conflict and commerce. The economy of ransoming and intercultural exchange in the early modern Mediterranean“. Zuletzt erschienen von ihm u.a.
- Wolfgang Kaiser (Hg.): La loge et le fandouk. dimensions spatiales des pratiques marchandes en méditerranée, moyen âge - époque moderne. Paris: Karthala 2014.
- Wolfgang Kaiser, Jocelyne Dakhlia (Hg.): Passages et contacts en Méditerranée. (Les musulmans dans l'histoire de l'Europe, 2.) Paris: Albin Michel 2013.